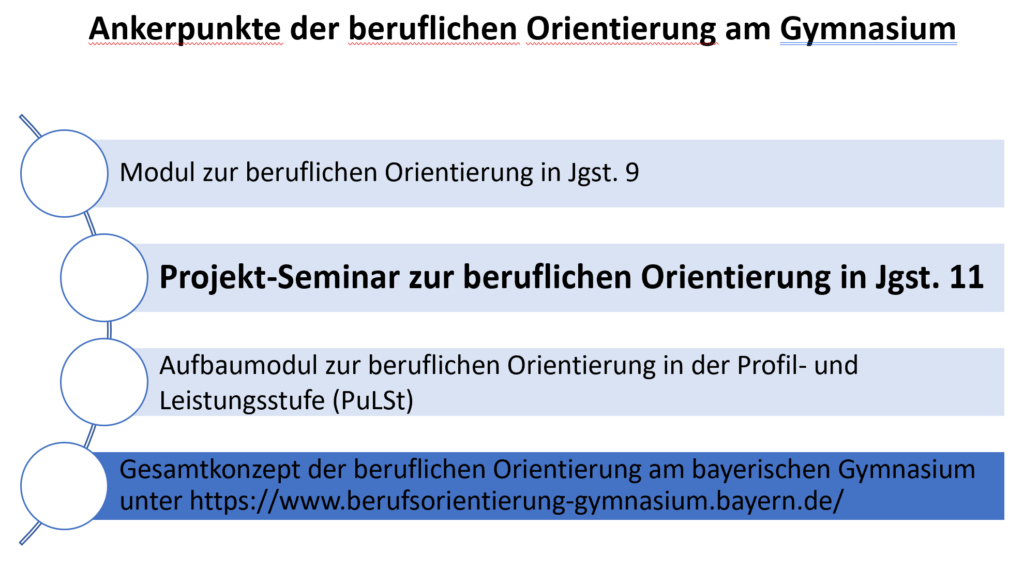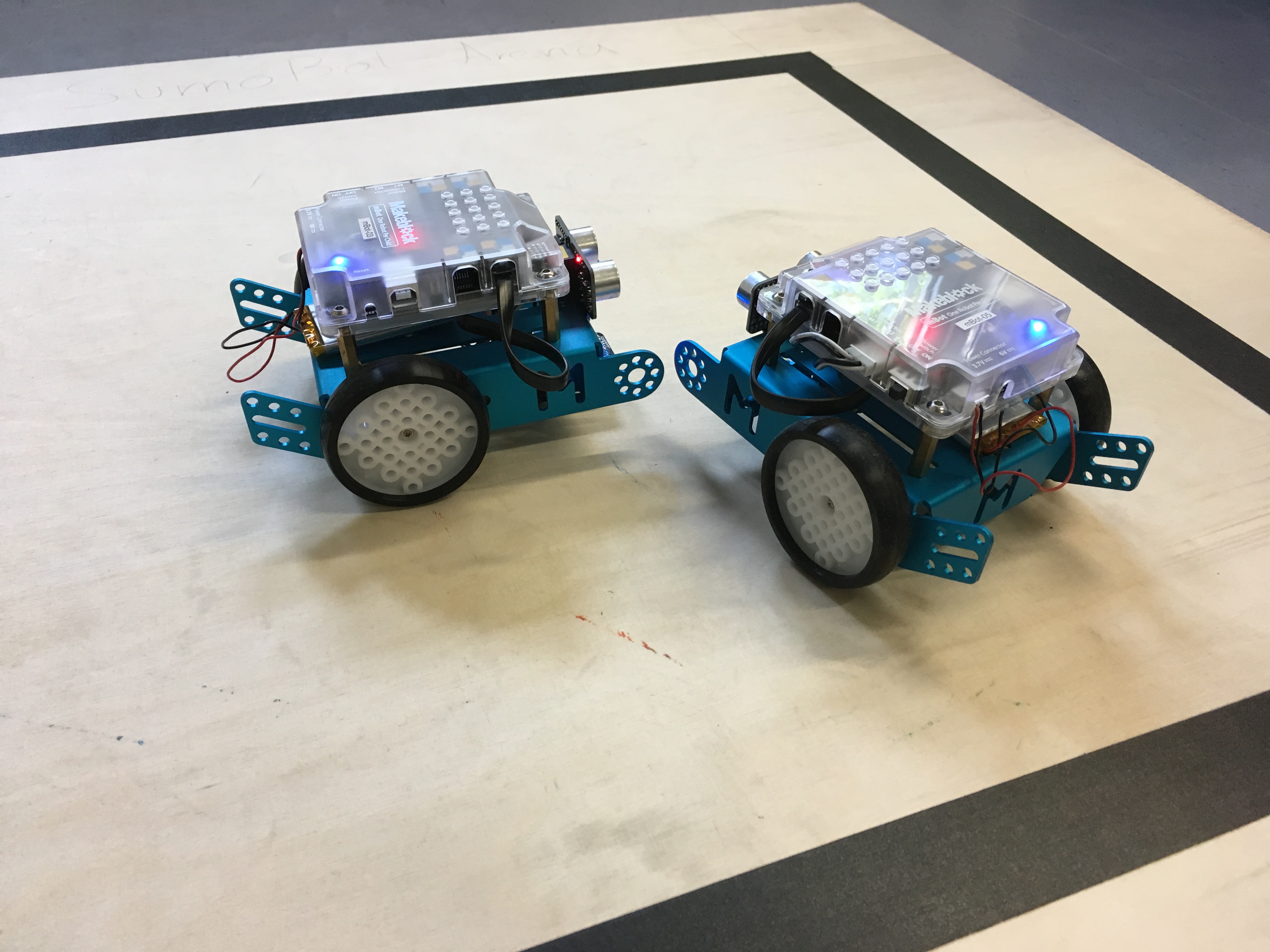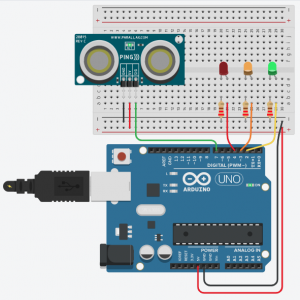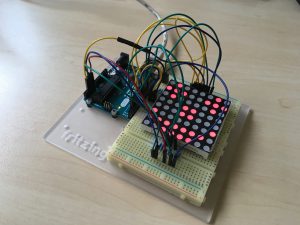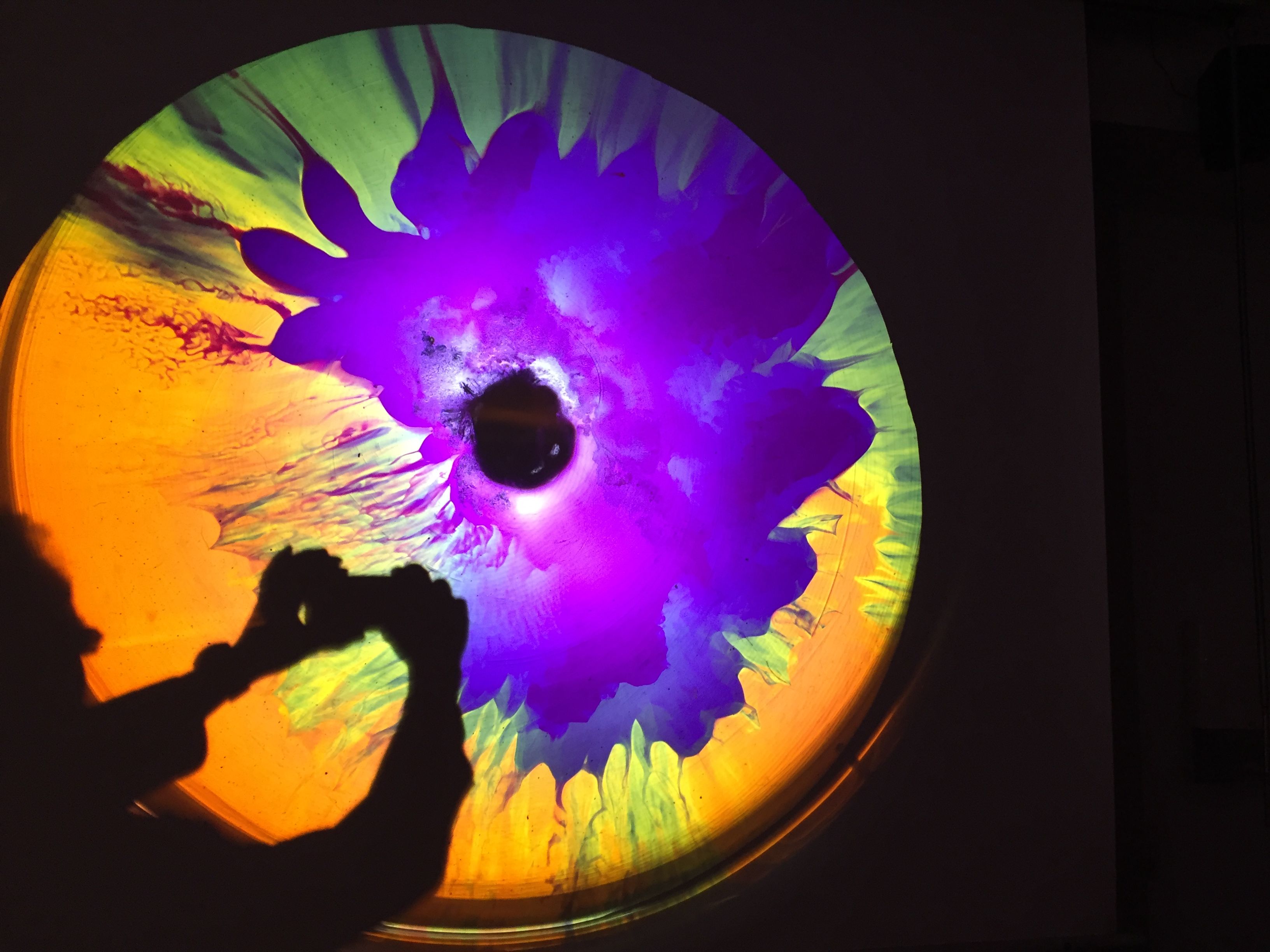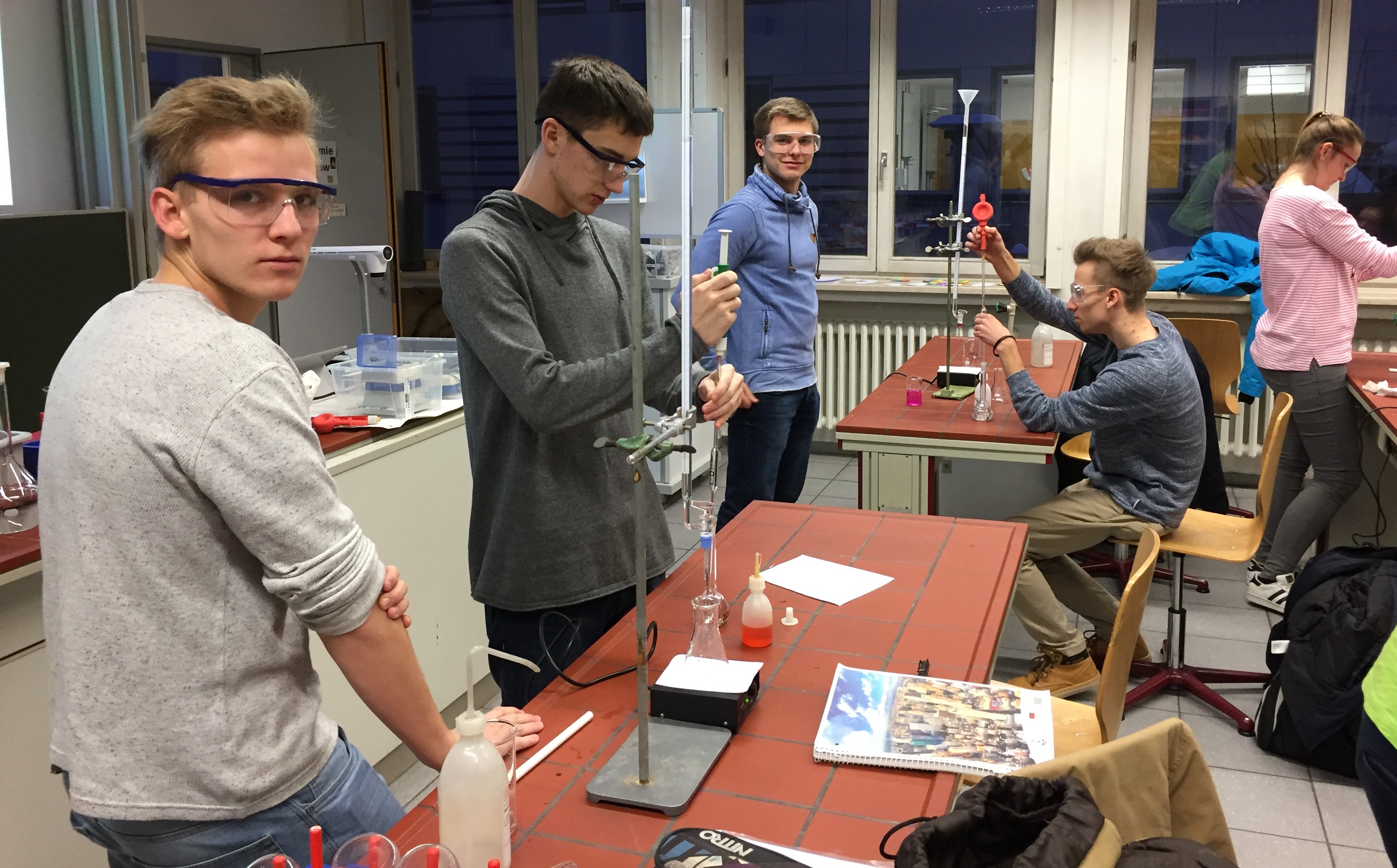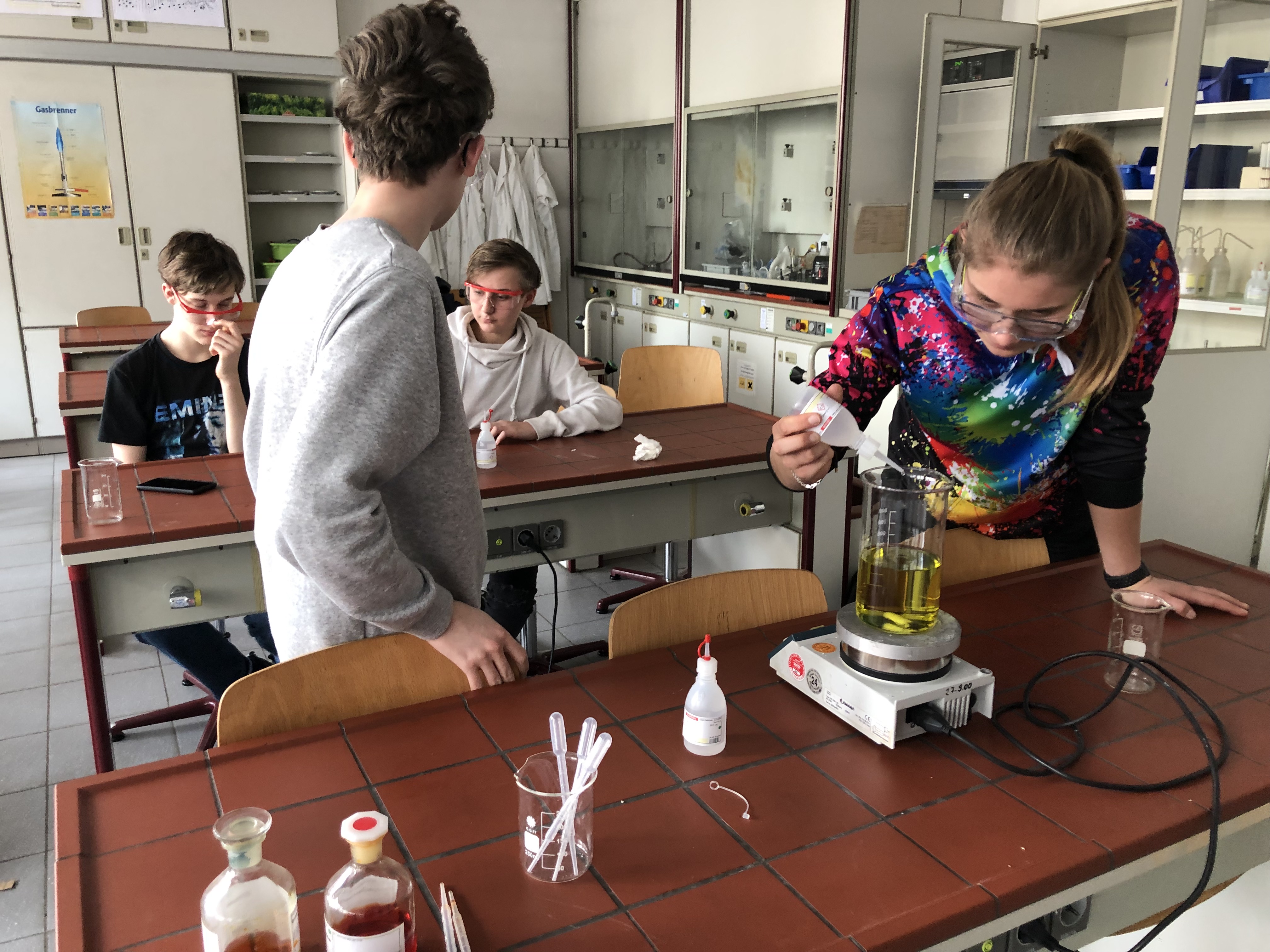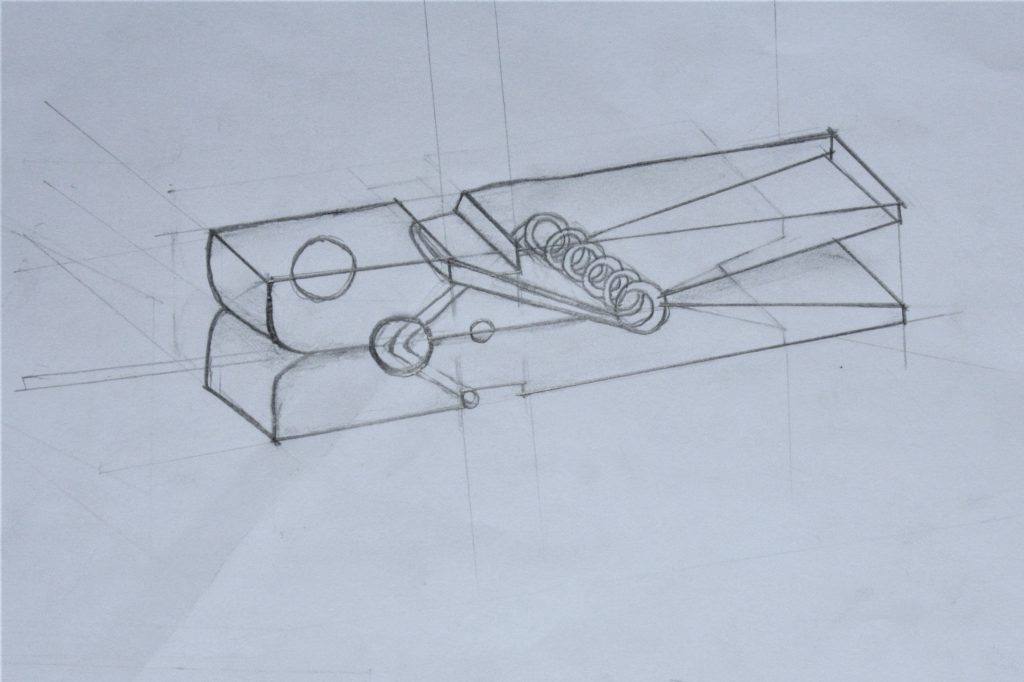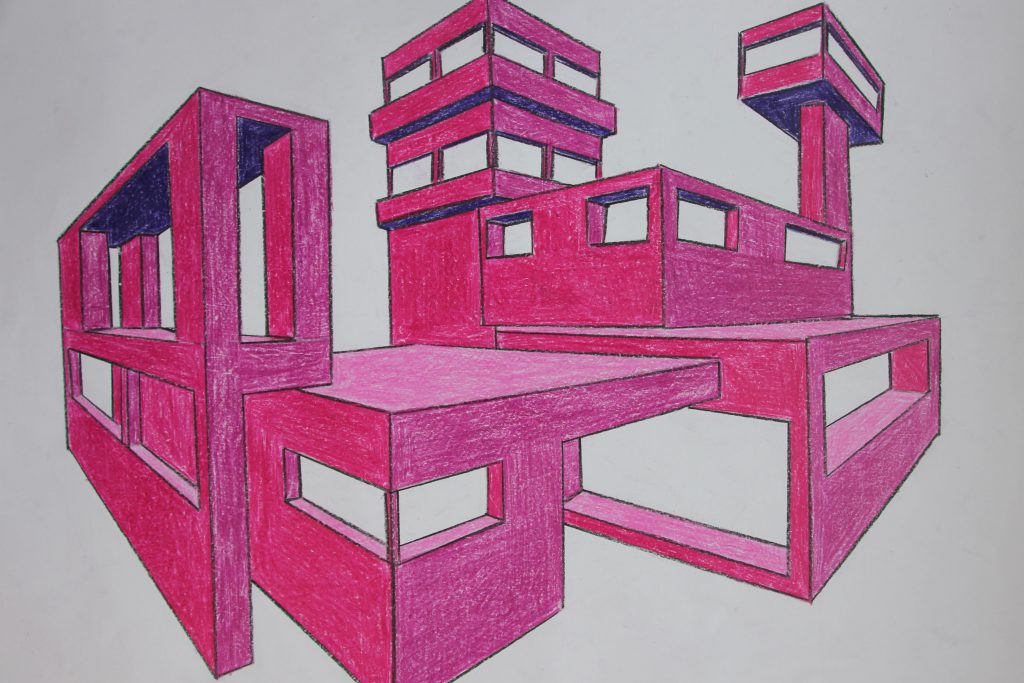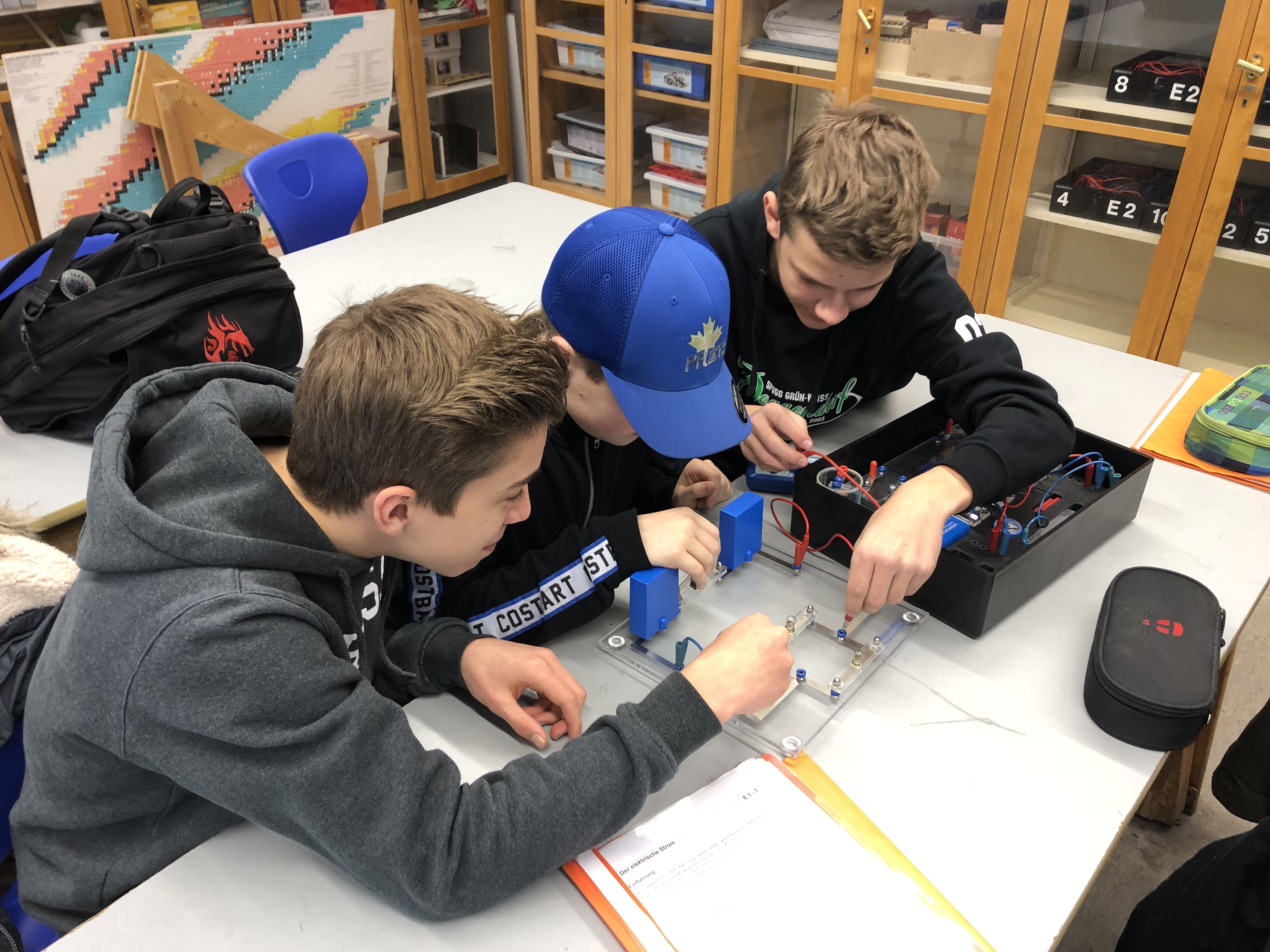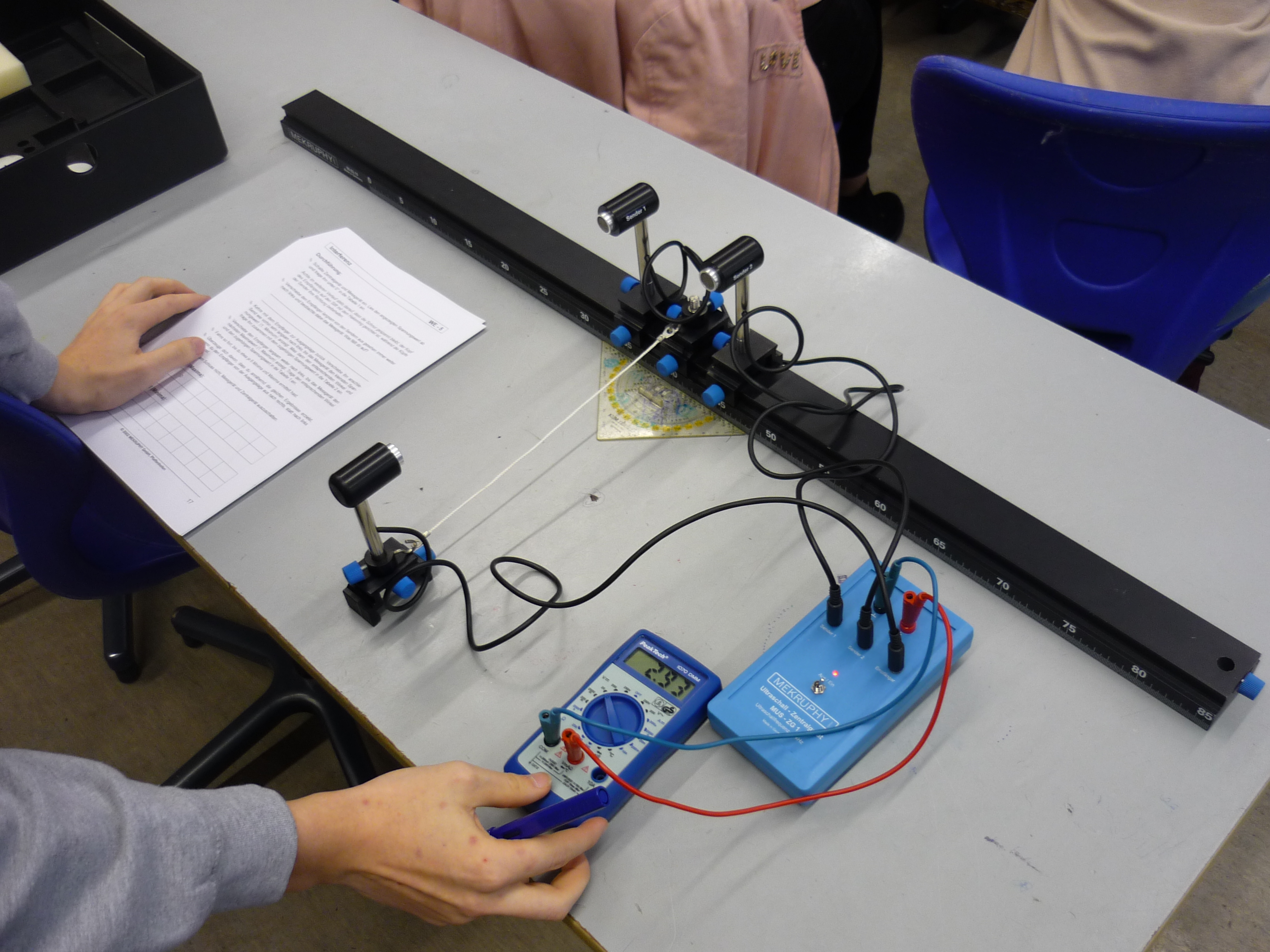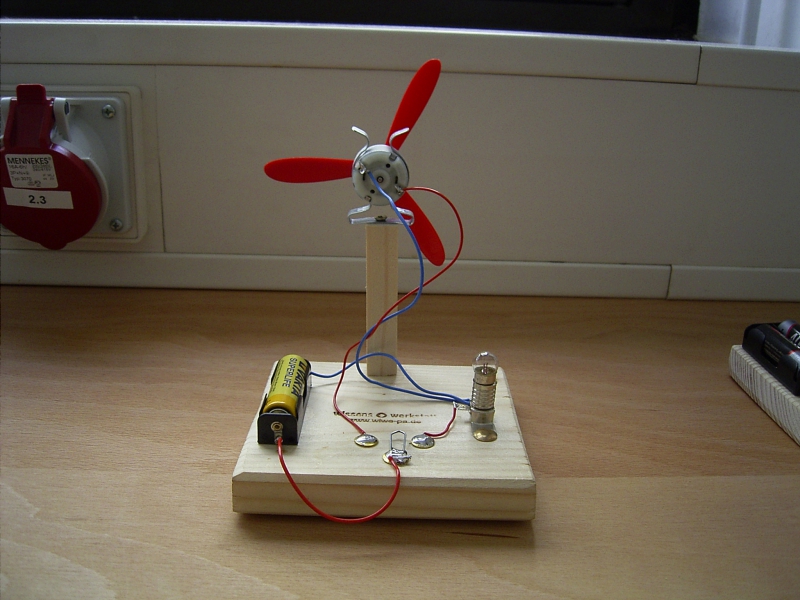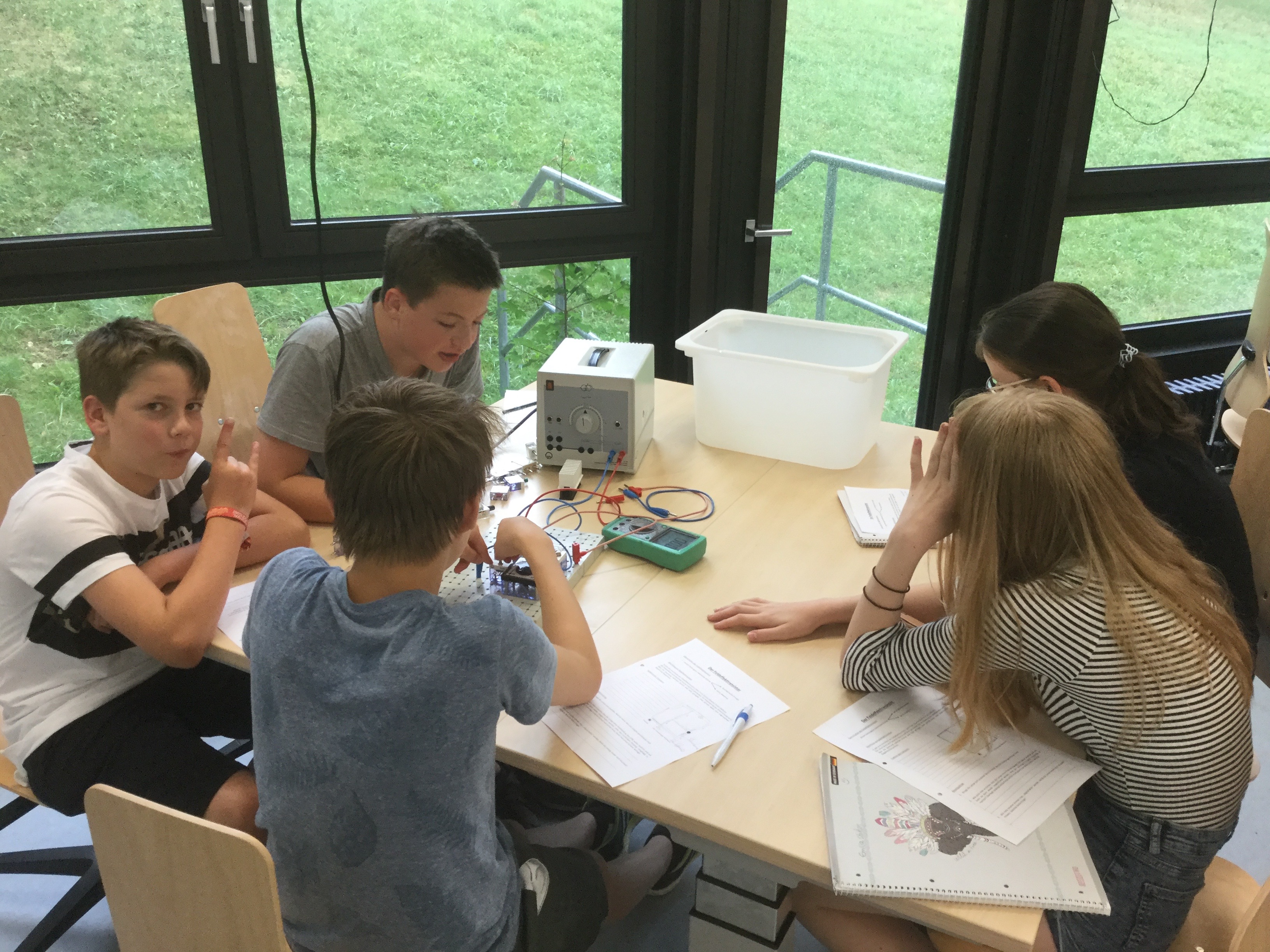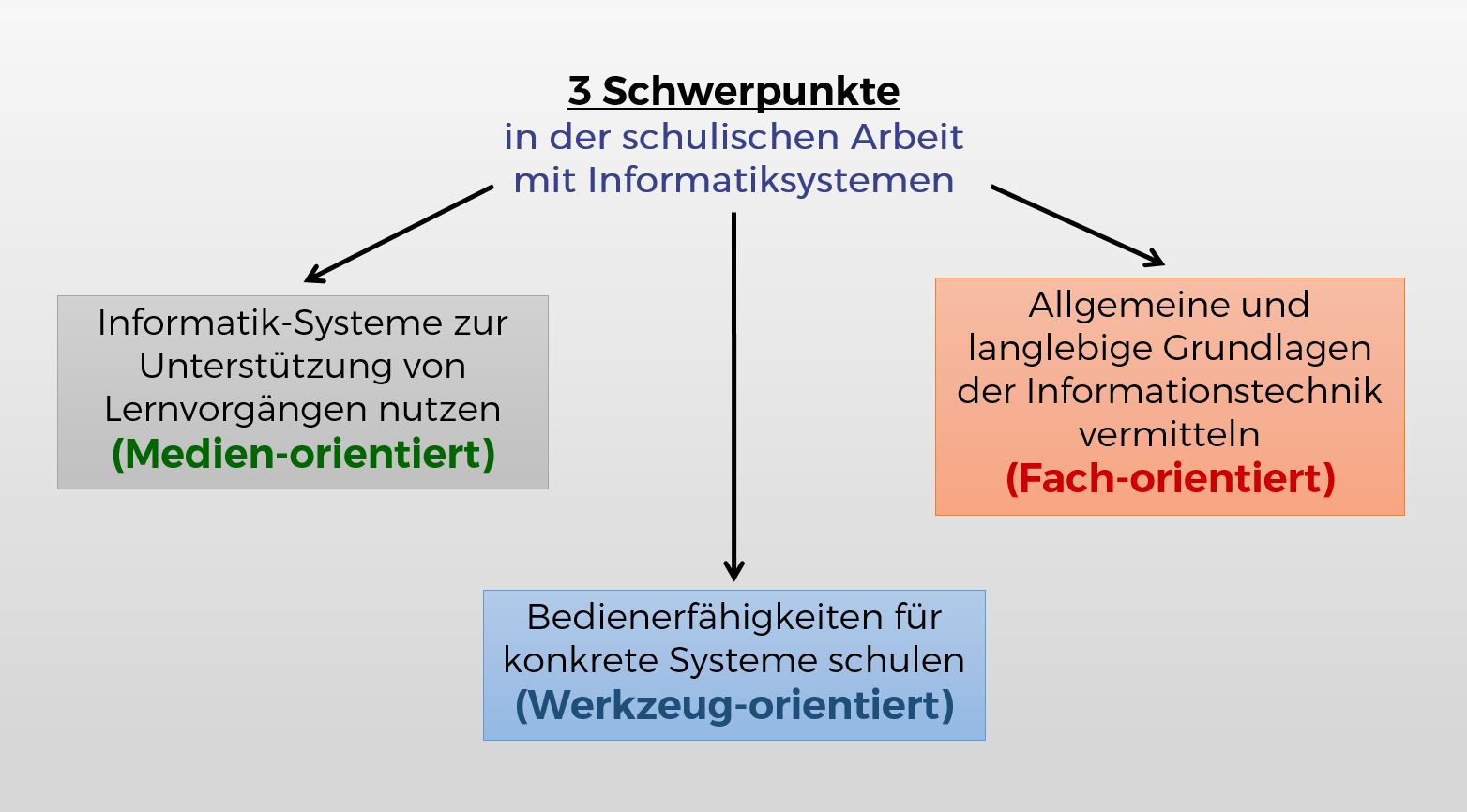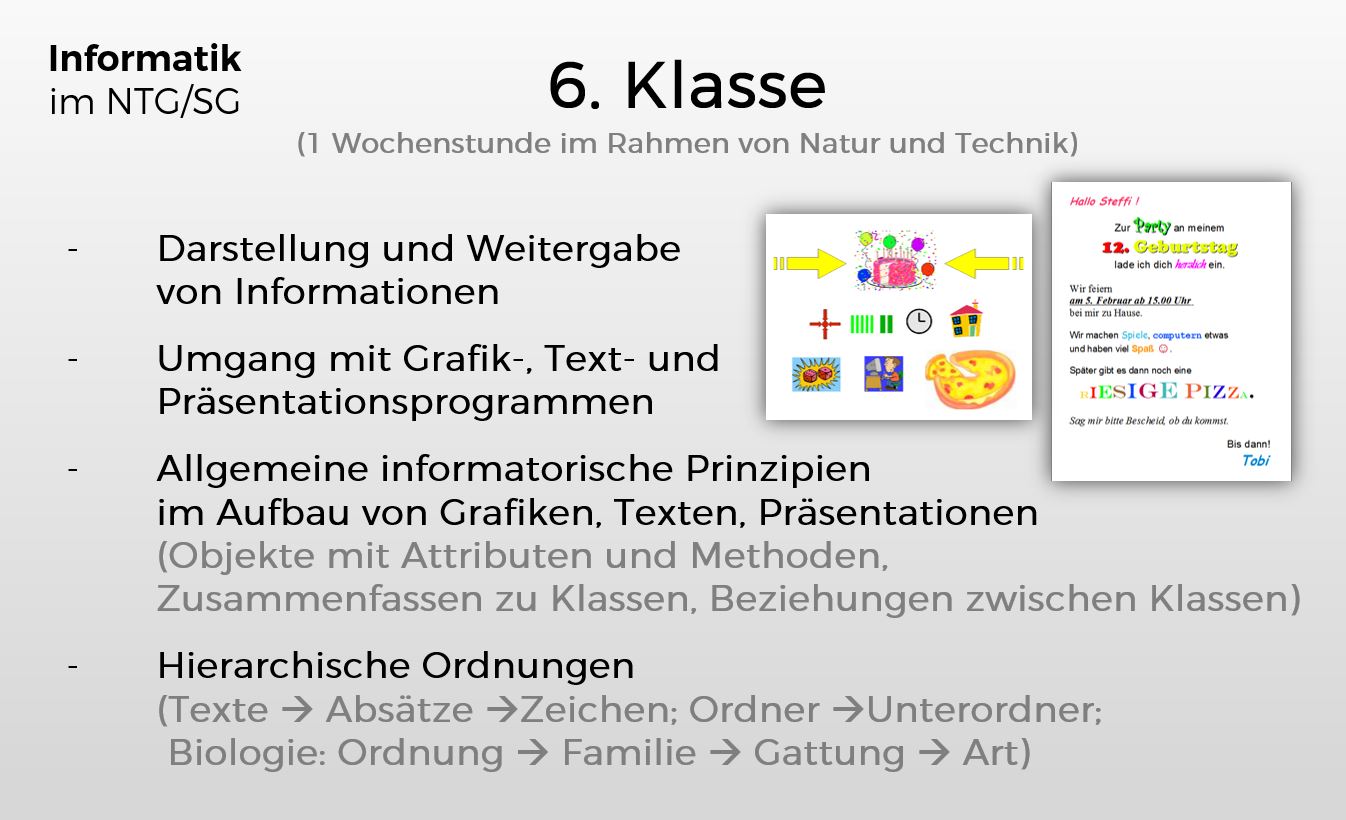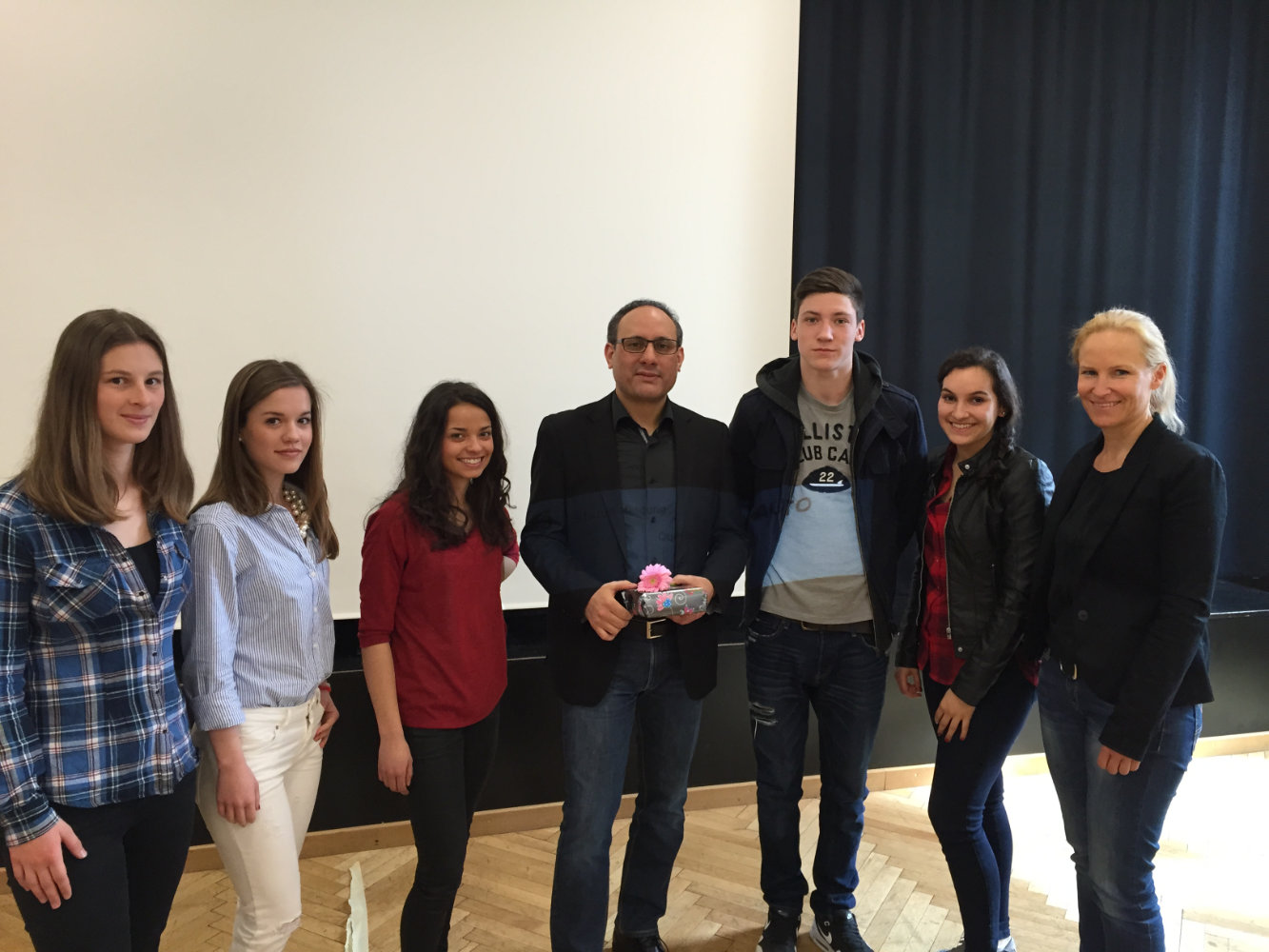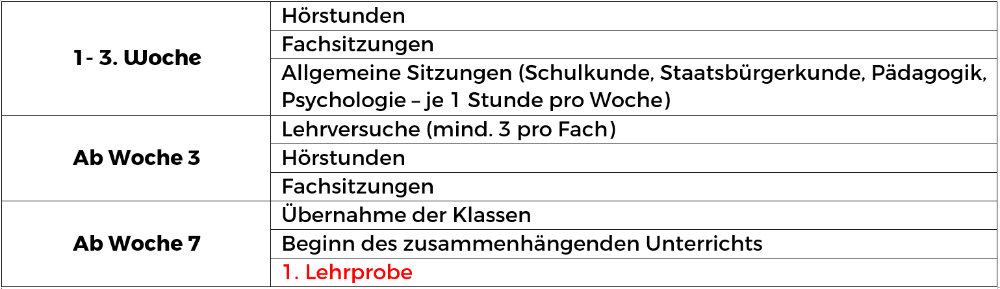Bedeutung — was ist das, woher kommt sie und was bedeutet überhaupt etwas?
Per Definition basiert die individuelle Auffassung von „Bedeutung“ auf gewissen Wertvorstellungen, seien sie nun religiöser oder gesellschaftlicher Natur, auf Erziehung, Erfahrungen und letztlich auf emotionalen Bindungen, die jeder von uns verschiedenartig aufbaut und pflegt.
Dementsprechend schwierig gestaltet es sich, der Frage „Was bedeutet Bedeutung?“ eine allgemeingültige Antwort zuzuweisen.
Der Versuch dessen zeigte sich am 17. und 18. Juli auf der comenianischen Theaterbühne — inszeniert vom Mittelstufentheater unter der Leitung von OStRin Patrizia Gillner und StRefin Ramona Kropf.
Gespielt wurde „Nichts“ — wortwörtlich. Jedenfalls ist das der Titel des im Jahre 2000 erschienenen — und 2010 ins Deutsche übersetzten — Romans der dänischen Autorin Janne Teller, welchen die Comenianer gemeinsam mit ihren Lehrerinnen bühnenreif machten.
„Nichts bedeutet irgendetwas! Das weiß ich schon seit langem. Deswegen lohnt es sich nicht, irgendetwas zu tun!“ — so lautet der erste Satz, den der Zuschauer hört; von den Schauspielerinnen und Schauspielern kanonartig und über den Zuschauerraum verteilt vorgetragen.
Und so schwer einzuordnen dieser Einstieg zu Beginn ist, umso alltäglicher wird die Geschichte fürs Erste fortgeführt: Eine Schulklasse kehrt nach den Sommerferien mit der typischen Motivationslosigkeit in den schulischen Alltagstrott zurück. Besprochen werden Banalitäten. Freizeitaktivitäten. Wie die Ferien gewesen sind. Wie der neue Lehrer wohl sein mag.
Dieser eröffnet mit gespielter Ambition die Stunde und sogleich eine weitere Etappe der moralischen Formung: Weisheiten wie „Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss nehmen, was übrig bleibt“, welche von den Schülern tonlos nachgesprochen werden, prägen das Unterrichtsbild.
Gestalterisch interessant eingesetzt wurde hier ein knallroter Trichter, durch den der Lehrer einzelnen Schülern seine Tugenden „eintrichtert“ — seine Aussagen ziehen sich die Schüler brechreizartig, auf Bändern geschrieben aus den Mündern. Eine ganz besonders eindrucksvolle Szene, die zeigt, wie Gesellschaft und Schule als diktaturgleiche Instanz einen Wertekonsens vorzugeben versuchen. In Zusammenarbeit mit den ambitionierten Eltern, welche ihren Kindern sagen, aus ihnen solle etwas werden, wird den deutlich überforderten, jedoch wehrlosen Schülern beigebracht, was von Bedeutung ist.
Dass es aber genau diese gar nicht gibt, hat sich einer der Schüler, der sich dem Zwang nicht beugen will, zum Mantra genommen: „Nichts bedeutet irgendetwas! Das weiß ich schon seit langem. Deswegen lohnt es sich nicht, irgendetwas zu tun!“ verkündet er und verlässt damit den Unterricht.
Seine nihilistischen Aussagen treiben seine gesellschaftlich vorgeformten Mitschüler auf die Palme — und ihn selbst auf den Pflaumenbaum. Aus vermeintlich sicherer Position im Geäst versucht Pierre-Anton, seine Mitschüler zur Bedeutungslosigkeit zu bekehren. Was diese jedoch nur mehr gegen ihn aufbringt. Nachdem der Plan, ihn mit Steinen zu bewerfen und ihn so zu vertreiben, scheitert, kommen die Jugendlichen nach fieberhaftem Überlegen zu der Erkenntnis, dass man Pierre-Anton einfach nur Dinge zeigen müsse, die Bedeutung haben, um ihn von seinen Ansichten abzubringen. Ein „Berg der Bedeutung“ soll ihm zeigen, dass er mit seinem Nihilismus falsch liegt.
Es beginnt also mit vergleichsweise kleinen, jedoch trotzdem unfreiwilligen Opfergaben an das Projekt :So muss sich die künstlerisch begabte Michelle von einem Stift verabschieden, der das Geschenk einer Freundin gewesen ist. Aus Rache verlangt diese vom musikbegeisterten Maxi, seinen MP3-Player zu opfern — und bereits hier wandelt sich der verzweifelte Versuch, Pierre-Anton zu überzeugen, zu einem emotional gesteuerten, immer kranker werdenden Spiel der Vergeltung: Je schmerzhafter das eigene Opfer empfunden wurde, desto mehr wird beim Opfer des nächsten verlangt, wobei man sich mit der Erklärung begnügt, dass ein besonders schmerzhaftes Opfer auch besonders bedeutend sei. Ein Tagebuch, das privateste Gedanken hegt; eine Flagge, die Identität und Toleranz repräsentiert, ein von klein auf geliebter Wellensittich — vor kaum etwas machen die Schüler mehr Halt, um Bedeutung zu finden.
Den absoluten Gipfel findet der Berg der Bedeutung in Johanna, die unter Schreien ihre Unschuld opfern muss. Traumatisiert und gnadenlos verlangt diese nun, dass Geigenspielerin Anna ihren kleinen Finger abgibt — ein Tribut, welches die Gruppe sogleich einfordert.
Die Eskalation endet somit mit einem Krankenwagen, der Polizei, Elternpredigten, Erziehungsmaßnahmen der Schule — und einem vergleichslosen Medienrummel. Der Berg der Bedeutung wird als Kunst gefeiert, Journalisten befragen die Jugendlichen zu ihrem vermeintlich ehrenhaften Projekt. Schließlich kauft ein Museum den Schülern den Berg für eine gewaltige Summe ab. In Ekstase und heller Begeisterung zelebrieren diese den Erfolg ihrer Aktion — und sind sich sicher: Spätestens jetzt kann Pierre-Anton nichts mehr einwenden.
Jedoch macht Ihnen dieser einen Strich durch die Rechnung: „Hätte der Berg so viel Bedeutung gehabt, dann hättet ihr ihn doch gar nicht verkauft!“
Und somit stehen die ratlosen Schüler wieder am Anfang. So viele Opfer haben sie gebracht, und doch plagt sie jetzt wieder die Frage, was überhaupt Bedeutung hat. Jedoch kann Pierre-Anton doch nicht triumphieren: Denn mit der letztendlichen Sinnlosigkeit der Bedeutungssuche geht die Erkenntnis einher, dass sich „Bedeutung“ gar nicht materiell messen lassen kann. Dass die Gegenstände, die gesammelt wurden, doch auch nur eine Bedeutung haben, weil hinter ihnen ein immaterieller Wert steht — die Liebe zu einem Familienmitglied, das Vertrauen in die Seiten eines Buches, die eigene Identität. Und so hat man Pierre-Anton am Ende doch irgendwie bezwungen, der, so die beiden Regisseurinnen, viel weniger eine reelle Person, als vielmehr die Stimme in jedem von uns ist, die uns dazu zwingt, unsere eigene Bedeutung zu suchen — und sie in den Werten zu finden, die die Schülerinnen und Schüler zum Ende des Stücks als leuchtende Ballons in die Höhe steigen lassen — Liebe. Zuneigung. Vertrauen. Hoffnung. Leben.
„Das Leben bedeutet etwas, das habe ich gelernt.“ — so endet die Geschichte. Und zeigt ganz klar: Das Leben hat einen Wert, und Bedeutung steckt in allen Ecken. Man muss sie nur finden — und das ganz sicher nicht in einer Definition, den Weisheiten eines Lehrers, in den Wünschen der Eltern oder auf dem Berg der Bedeutung, der in irgendeinem Kunstmuseum vor sich hin gammelt — sondern ganz einfach in uns selbst.
Alessandra Aue

Die Comenianer machten sich Gedanken darüber, was im Leben eine Bedeutung hat.